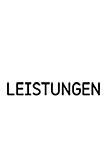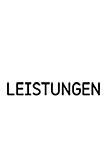Fotos © Robert Wimmer
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 17. November 2012
»Ich rede mit dem Papier«
Christine Dobretsberger im Gespräch mit Monika Helfer
Die Schriftstellerin Monika Helfer über ihre Kindheit, den frühen Drang, Geschichten aufzuschreiben, ihre Bewunderung für Tschechow - und über ihre Lebens- und Künstlerpartnerschaft mit dem Schriftsteller Michael Köhlmeier.
"Wiener Zeitung": Frau Helfer, seit Ihrem Roman "Oskar und Lilli", einer berührenden Geschichte rund um zwei Geschwister, die bei verschiedenen Zieheltern aufwachsen, verfolge ich Ihr Werkschaffen und staune immer wieder über Ihr Vermögen, wie Sie sich speziell in die Gedanken- und Gefühlswelt von Kindern hineinversetzen können. Woher rührt diese Gabe?
Monika Helfer: Ich komme aus einer großen Familie, wir waren sechs Kinder, und selbst habe ich ja auch vier Kinder. Als ich elf Jahre alt war, starb meine Mutter und die Kinder wurden in der Familie aufgeteilt. Wir drei Mädchen kamen zu einer Tante in eine winzige Wohnung. Sie hatte selber drei Kinder. Die ganze Situation war enorm eng, das waren wir nicht gewohnt.
Wo wohnten Sie zuvor?
Aufgewachsen sind wir auf der Tschengla, das ist eine Parzelle oberhalb von der Gemeinde Bürsenberg, in der Nähe von Bludenz. Mein Vater arbeitete als Verwalter in einem Erholungsheim für Kriegsversehrte. Da er selbst kriegsversehrt war, bekam er diesen Job. Wir wohnten auch in diesem riesigen Haus und fühlten uns wie die Fürstenkinder. Obwohl meine Mutter oft krank war, hatten wir es wahnsinnig schön. Damals gab es in dieser Gegend noch keinen Fremdenverkehr, nur ein paar Bauernhöfe und eben dieses Heim. Im Winter sind wir mit den Skiern, und sonst zu Fuß in die Schule gegangen. Wir hatten einen langen Schulweg - mindestens zwei Stunden, aufwärts um einiges länger. Selten durften wir mit der Seilbahn fahren, die war nämlich nur für die Urlaubsgäste vorgesehen.
Und mit einem Schlag war Ihre als schön empfundene Kindheit vorbei.
Das war wirklich ein Schock. Ich denke, mein Interesse oder meine Zuneigung für Kinder stammt aus dieser Zeit, als wir plötzlich allein waren. Die Tante hat sich schon um uns gekümmert, aber ich fühlte mich einfach völlig verlassen. Ich dachte mir oft, wenn ich am Abend nicht heimkomme, merkt das bei so vielen Leuten ohnedies niemand. Gerade in diesem Alter empfindet man sehr intensiv. Einerseits wird man hart, aber man wird auch ganz weich - weich mit Gleichgesinnten, mit Menschen, die auch verletzt worden sind.
In Ihrem jüngsten Werk, "Die Bar im Freien", erzählen Sie dem Leser über 100 kurze Geschichten, die ebenfalls in der Mehrzahl von Menschen bevölkert sind, die man als gesellschaftliche Randfiguren bezeichnen könnte: Heimatlose, Trauernde, Suchende . . . Woher nahmen Sie die Inspiration für diese Texte?
In der Welt, in der ich mich bewege, begegnen mir einfach oft Menschen mit existenziellen Problemen. Das berührt mich einfach sehr - und das sind auch die Geschichten, die mich interessieren.
Heißt das, die Geschichten in Ihrem neuen Buch haben einen konkreten Realitätsbezug?
Nein, mit Ausnahme von einigen wenigen Texten ist das nicht der Fall. Es ist vielmehr so, dass ich mir zu Menschen, die mir etwa im Zug oder auf der Straße begegnen, gerne eine Geschichte ausdenke.
Sie fantasieren sich also zu fremden Menschen Geschichten?
Ja. Natürlich hat man als Basis eine gewisse Menschenkenntnis. Ich hätte dieses Buch auch nicht früher schreiben können. Als junger Mensch hat man einfach noch nicht so viele Menschen kennen gelernt. Dann kämen die Geschichten nur aus der Fantasie.
Viele der Texte aus "Der Bar im Freien" wirken auf den ersten Blick surreal, sind aber gleichzeitig immer auch möglich, manchmal in ihrer schicksalhaften Brutalität auch zutiefst realistisch. Der Untertitel des Buches lautet: "Aus der Unwahrscheinlichkeit der Welt". Was genau darf man sich darunter vorstellen?
Das Motto habe ich deshalb gewählt, weil ich finde, dass viele Geschichten so unwahrscheinlich klingen, aber trotzdem wahr sind oder wahr sein könnten.
Die einzelnen Geschichten sind durchschnittlich maximal zwei Seiten lang. Man hat als Leser das Gefühl, dass Ihnen diese kurze Form liegt . . .
Die kurze Form liegt mir total, weil es in gewisser Weise auch ein Trick ist. Wenn man wenig von den Menschen weiß, über die man schreibt, sind Menschenkenntnis und Fantasie ausreichend. Müsste man die Geschichten ausbauen, wäre man vielleicht kitschgefährdet, weil man sich eine ganze Menge zu den Leuten dazu denken müsste. Dann weiß ich nicht, ob ich noch diese Präsenz hätte. Aber in dieser Kürze merke ich selbst, dass ich es oft hinkriege. Es ist ein bisschen so, wie wenn man einen Schmetterling, den man ja auch nicht fangen oder kaputtmachen möchte, für einen ganz kurzen Moment berührt und ihn dann sofort wieder wegfliegen lässt.
weiterlesen: Wiener Zeitung
|