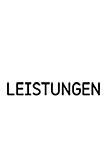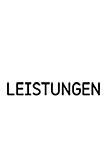© Gabriela Brandenstein
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 12. Juni 2021
»Ich gehe meinen Figuren nach«
Christine Dobretsberger im Gespräch mit Peter Rosei
Der Wiener Schriftsteller, der am 17. Juni seinen 75. Geburtstag feiert, über die Beschaffenheit von Glück, die Ungenauigkeit der Sprache - und seine mehr als 30-jährige Freundschaft mit H. C. Artmann.
Wiener Zeitung: Herr Rosei, den Titel Ihres neuen Buches "Das Märchen vom Glück" kann man auf zwei Arten lesen – im Sinne von "Das Glück ist ein Märchen" oder tatsächlich als märchenhafte Geschichte. Diese Ambivalenz ist sicher kein Zufall ...
Peter Rosei: Ja, das ist Absicht. Wenn man Glück im religiösen Kontext betrachtet, ist es Gnade, wenn man es hierarchisch auffasst, ist es Gunst. Die Geliebte gibt die Gunst, hat man früher gesagt. Glück hat etwas Koboldhaftes, weil man es nirgends festmachen kann und schattiert sehr schnell in Unglück. Was das Buch selbst anlangt: Märchen erzählen normalerweise grausame Geschichten. Das Märchenszenario ist in der Regel von der Wirklichkeit nicht weit weg, sondern behandelt sie und löst sie dann glückhaft auf. In meinem Buch kommt relativ viel Unglück vor, wie es im Leben leider so ist. Dann gibt es diese Glückmomente, die der Leser auffinden kann.
Mit wenigen Ausnahmen kommen die Protagonisten Ihres neuen Romans aus sogenannten einfachen Verhältnissen. Beim ungarischen Supermarktangestellten Andràs hat man die Hoffnung, dass er ein gewisses Talent zum Glück hätte, wird aber letztlich von Ihnen relativ schnell aus dem Verkehr gezogen.
Den habe nicht ich aus dem Verkehr gezogen. Sein erstes Glück entpuppt sich als eine Illusion, seine Frau ist ihm untreu, was aber nicht bedeutet, dass er vorher nicht mit ihr glücklich war. Ich sage immer: Die Menge von Unglück ist eigentlich größer als die Menge von Glück, die man erlebt, und man ist gut beraten, wenn man sich auch mit dem Unglück, mit Tod, Krankheit und Leid beschäftigt. Je älter man wird, desto mehr wird man damit konfrontiert. Für Helmut Eisendle oder für meinen Freund H. C. Artmann habe ich die Totenrede gehalten. Dem muss man sich stellen. Man darf oder man sollte nicht verzweifeln.
Da jedes Märchen zumeist auch eine Prinzessin hat, ist dies in Ihrem Roman die aus Brünn stammende Eva. Eine Frau, die sich unverdrossen immer wieder auf neue Beziehungen einlässt, Enttäuschungen gut wegsteckt und dank ihrer starken Persönlichkeit nie die Hoffnung aufgibt. Ist diese Eva eine reine Fantasiefigur?
Wie alle meine Figuren ist Eva aus dem Lebensstoff heraus geschaffen. Ich kenne Brünn, Szombathely usf. Zu Eva wäre noch zu sagen: Es gibt eine Glücksvergessenheit und auch das Gegenteil, eine Art Glücksbereitschaft: Du hast Glück und du hältst es fest.
Das Glücksstreben der Figuren ist einerseits auf beruflichen Aufstieg gerichtet, andererseits und im Besonderen auf ein Du, auf die Suche nach Beziehung und Liebe.
Das Du ist das Wichtigste. Die Liebe ist der Motor, dass man dieser Einsamkeit entkommt, in der man bewusst oder unbewusst steckt. Deshalb heißt es bei Shakespeare, die Liebe hat keinen Preis, weil man so viel dafür bekommt.
Was hat Sie letztlich bewogen, diesem Buch am Ende doch eine versöhnliche Wendung zu geben?
Ich gehe meinen Figuren nach. Du hauchst den Figuren Leben ein, und sie bewegen sich dann in dem Raum, den du vorgibst. Es gibt Bücher, wo ich dann einige Figuren ausgeschieden habe, weil sie einfach nicht entwicklungsfähig waren, oder ich konnte das, was diese Figuren ausdrücken hätten sollen, in andere Figuren integrieren. Der Jammer mit dem Romanschreiben ist, dass man immer Figuren braucht. Es wäre mir viel lieber, wenn man das, was man transportieren möchte, anders ausdrücken könnte. Denn die Figuren sind natürlich auch Tyrannen, die ab einem gewissen Grad ein Eigenleben entwickeln.
Ohne zu viel vom Plot zu verraten, wird am Ende des Buches ein "Anrecht auf Glück" für die Protagonistin und ihren Partner in Aussicht gestellt.
An diesem Ende habe ich lange gearbeitet, weil die beiden sozial ja sehr weit voneinander entfernt sind.
Wie Sie das Buch ausklingen lassen, war keine vorab getroffene Entscheidung, sondern hat sich im Zuge des Schreibens entwickelt?
Das muss immer so sein. Wenn du das erzählerische Kalkül einmal festlegst, zwingt das Kalkül dich, ihn im Verlauf dann weiterzuverfolgen. Manchmal geht es nicht weiter, dann muss man aufhören und sagen: gescheitert – gibt es auch!
Bezeichnend für Ihr literarisches Schaffen ist u.a. die Tatsache, dass Sie keine 800-Seiten-Romane schreiben, sondern Inhalte sehr verdichten.
Von Einstein gibt es den Ausspruch: "Sag es so einfach wie möglich – aber nicht einfacher." Dem füge ich noch hinzu: Sage es so, dass es jeder Mensch verstehen kann. Was dabei im Verborgenen bleibt, ist die intellektuelle Vorarbeit. Man kann nie zu viel wissen, bevor man zum Schreiben anfängt. Die Ökonomie, das soziale Leben der Figuren, die Psychologie etc. Das ergibt dann die Erzählbewegung. Zuerst alles durchdenken und beim Schreiben möglichst wenig denken und eben schauen, was die Figuren machen – sie handeln dann ohnehin von selbst.
Weiterlesen: Wiener Zeitung
|