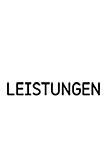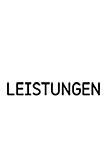© Tatjana Sternisa
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 18. Dezember 2021
»Für ein neues Miteinander«
Christine Dobretsberger im Gespräch mit Mari Lang und Didi Drobna
"Seelenverwandte" (Folge 13): Die Schriftstellerin Didi Drobna und die Podcasterin Mari Lang über typische Männer- und Frauenfragen.
"Wiener Zeitung": Frau Lang, als ich Sie gefragt habe, wen Sie sich als seelenverwandten Gesprächspartner wünschen, haben Sie sich für Didi Drobna entschieden. Das hat sicher gute Gründe ...
Mari Lang: Wir kennen einander schon sehr lange. Das erste Mal richtig ins Gespräch kamen wir im Rahmen des Literaturwettbewerbs auf Schloss Wartholz. Didi saß damals in der Jury und ich moderierte. Dieser Abend hat einen starken Eindruck bei mir hinterlassen und ab diesem Zeitpunkt waren wir über Social Media vernetzt.
Didi Drobna: Meine frühste Erinnerung an dich geht sogar noch zwei Jahrgänge zurück. Auch damals hast du in Wartholz sehr kompetent und sympathisch moderiert und ich war die aufgeregte Literaturwettbewerbsfinalistin, die bei der Nennung ihres Namens übermotiviert auf die Bühne gestürmt ist, was eigentlich gar nicht vorgesehen war.
Lang: Sehr vertieft hat sich unsere Freundschaft dann durch das Laufen. Ich trainierte damals für die 10-Kilometer-Challenge beim Frauenlauf - und es war cool, dies gemeinsam zu tun.
Während des Trainings blieb noch Luft zum Reden?
Drobna: Ja, da reden wir wirklich in einer Tour durch.
Lang: Und da ist dieses Gefühl entstanden, das ich als seelenverwandt bezeichnen würde.
Würden Sie sagen, dass Ihre Freundschaft auch Auswirkungen auf Ihr berufliches Schaffen hat?
Lang: Auf jeden Fall, weil wir natürlich auch viel über die Arbeit sprechen.
Drobna: Ich kann mich erinnern, als du mir sehr früh von deiner Idee des Podcasts erzählt hast. Das war für mich sehr spannend, weil ich dir so richtig beim Denken und Weiterentwickeln dieser Idee zuhören und zuschauen konnte. Meistens ist es ja unter uns Schreibenden so, dass die beste Hilfe die Hilfe zur Selbsthilfe ist. Einfach laut vor sich hinzureden und jemanden zu haben, der zuhört, ist meiner Erfahrung nach die größte Hilfe. Die meisten Fragen kann man sich dann oft selber beantworten.
Frau Drobna, Ihr jüngstes Buch, "Was bei uns bleibt", unterscheidet sich thematisch stark von Ihren beiden vorangegangenen Romanen. Was hat Sie bewogen, sich mit dem Zweiten Weltkrieg auseinanderzusetzen, konkret mit der bisher eher unbekannten Geschichte der Hirtenberger Munitionsfabrik?
Drobna: Ich hatte von Anfang an immer die Figur Klara vor meinem inneren Auge, diese ältere Frau, die am Ende ihres Lebens zurückblickt und sich selbst die Frage stellt: Gibt es etwas zu bereuen? Eher zufällig kam mir die Idee, ihr diese Vergangenheit in einer Munitionsfabrik zu geben. Viele Entscheidungen beim Schreiben erfolgen intuitiv und unbewusst. Dann begann ich zu recherchieren und stieß rasch auf Hirtenberg und war sehr überrascht, dass ich noch nie von diesem Ort gehört hatte, der nur 30 Autominuten von Wien entfernt ist und wo 160 Jahre lang die größte Munitionsfabrik Mitteleuropas stand. Ich bin dann wie Alice im Wunderland ins Kaninchenloch gefallen, habe mit Zeitzeuginnen gesprochen, in Archiven recherchiert, auch im Firmenarchiv von Hirtenberg, das sonst für die Öffentlichkeit eigentlich nicht zugänglich ist.
Drobna: Mir war klar, dass so ein heikles historisches Thema viel Sensibilität und präzise Recherchen verlangt. Am Anfang habe ich mich auch ein bisschen davor gefürchtet. Sehr gewundert hat mich, dass in Hirtenberg keine Gedenktafel existiert, die auf die Vergangenheit hinweist. Dass Österreichs Geschichte dort einfach so vor sich hingammelt, fand ich zum Teil schockierend. Überrascht hat mich auch, dass dieses Thema künstlerisch bisher in keiner Art aufgearbeitet worden ist. Also dachte ich mir, gut, dann werde ich mich mit meiner Klara trauen.
Ich habe gelesen, dass Sie im Zuge Ihrer Recherchen auch selbst Schießunterricht genommen haben.
Drobna: Ich nahm privat Schießstunden, weil ich den Eindruck hatte, wenn ich schon über Waffen und Munition schreibe, sollte ich das vielleicht auch einmal ausprobieren.
Weiterlesen: Wiener Zeitung
|