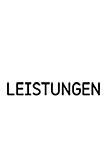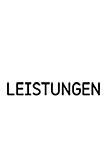© Peter Jungwirth
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 23. April 2022
»Es soll kein billiger Lacher sein«
Christine Dobretsberger im Gespräch mit Klaus Eckel und Thomas Mraz
"Seelenverwandte" (Folge 14): Der Kabarettist und der Schauspieler über ihre Arbeit und Humor als verbindendes Element.
"Wiener Zeitung": Herr Eckel, weshalb haben Sie sich Thomas Mraz als seelenverwandten Gesprächspartner gewünscht?
Klaus Eckel: Ich habe 74 Seelenverwandte angeschrieben ...
Thomas Mraz: ... und alle anderen haben abgesagt.
Eckel: Nein, ernst gesprochen, ich glaube, dass wir einen sehr ähnlichen Zugang zur Welt haben. Wir haben beide diese zweifelnde, beobachtende Haltung und eine sehr ähnliche Humorfärbung. Männer kommunizieren ja ex-trem stark über den gemeinsamen Schmäh, der muss laufen. Uns verbindet auch, dass wir unseren Beruf, aber uns selbst nicht immer so ernst nehmen.
Mit anderen Worten, Sie können über sich selber lachen?
Mraz: Auf jeden Fall. Ich glaube in jeder Beziehung, auch in einer Arbeitsbeziehung, ist Humor sehr wichtig - und umso besser, wenn es darüber hinaus eine gemeinsame Humorebene gibt.
Humor ist bekanntlich etwas sehr Individuelles, jeder findet etwas anderes lustig.
Eckel: Eben, das ist, glaube ich, die Synchronisation bei uns, und einer der Gründe, warum unsere Zusammenarbeit so gut funktioniert. Als ich das Theaterstück "Après Ski - Ruhe da oben" schrieb, wusste ich genau, dass Thomas die ideale Besetzung für dieses Einpersonenstück ist, weil ihm mein Humor vertraut ist und er damit umzugehen weiß.
Mraz: Global beobachtet, gibt es die Tendenz, dass der Humor immer brachialer, schmutziger und ordinärer wird. Es gibt keine Tabus mehr. Und je mehr Tabus man bricht, desto besser scheint es um den Humor bestellt zu sein. So ist Klaus gar nicht. Sein Anspruch ist vielmehr, es muss lustig sein, Niveau haben und trotzdem berühren. Letztens haben wir darüber gesprochen, was für uns eine gute Komödie auszeichnet: Sie muss immer auch Tiefgang haben, damit sie berührt. Es soll kein billiger Lacher sein. Das vermeidet Klaus zur Gänze - und das ist etwas, das uns bei der Arbeit total verbindet.
War "Après Ski" die erste gemeinsame Zusammenarbeit?
Mraz: Ja, und eine große Herausforderung. Ein Einmannstück ist schon schwierig, aber wenn du dich darüber hinaus die ganze Zeit über nicht bewegen kannst, weil du auf einem Sessellift festsitzt, dann ist das ein ziemlicher Balanceakt, dass die Leute dranbleiben.
Wie ist das für einen Schauspieler, wenn man den Autor eines Stückes so gut kennt: Empfindet man das eher als Vorteil oder erhöht das den Druck?
Mraz: Druck wurde von Klaus keinesfalls ausgeübt.
Eckel: Da "Après Ski" produktionstechnisch nicht immer einfach war, saß ich viel in den Proben. Wir sind, wie schon gesagt, beide große Zweifler - und diese Zweifel spornen uns an. Hinzu kommt, dass wir beide keine Menschen sind, die viele Ausreden bei den anderen suchen, da sind wir ebenfalls ziemlich ähnlich gestrickt. Am schönsten ist es, wenn man gemeinsam einen Moment der Erkenntnis hat, egal, ob das ein kreativer Prozess ist oder ob man über etwas Gesellschaftspolitisches nachdenkt. Wir hatten schon oft solche Momente, zwischen uns gibt es ein Spiel der guten Ideen, das hypt sich dann nach oben, da jazzen wir uns richtig rauf - und das ist cool.
Mraz: Das war auch bei diesem Theaterstück der Schlüssel, dass Klaus immer gesagt hat: Die beste Idee gewinnt letztlich. Das war Gold wert. Sowohl aus Autorensicht, aber auch für alle anderen Beteiligten. Es machte keinen Unterschied, ob ein Vorschlag vom Regieassistenten oder vom Beleuchter kam: Wenn ihn alle gut fanden, war er gleich viel wert, als ob diese Idee von Klaus gekommen wäre. Das war total befreiend und zugleich gegenseitig befruchtend.
Ihr jüngstes gemeinsames Projekt war das Verfassen des Drehbuchs zur ORF/BR-Komödie "Eigentlich sollten wir". Von wem stammt die Idee zu diesem Stück?
Eckel: Die Idee kam von mir. Ursprünglich wollte ich einen Roman schreiben zum Thema, wie Familien heute funktionieren, speziell über deren Überkonsum. Allein am Kinderspielzeug sieht man, was da oft falsch läuft. Egal, welche soziale Schicht: Die Kinder haben viel zu viel, die Kinderzimmer werden vollgeräumt mit irgendeinem Klumpert. Das ist ein interessantes Phänomen. Ich sehe es selber an mir: Man verwechselt oft Liebe und Zuneigung mit der Anzahl der Gegenstände, die man seinen Kindern schenkt. Das hat mich als Thema interessiert und dazu bewogen, eine Geschichte darüber zu schreiben, wie ein Familienvater gegen diese Situation ankämpft. Dann schickte ich Thomas die ersten 70 Seiten und er meinte: Das ist kein Buch, das ist ein Film. Ab diesem Zeitpunkt war er im Drehbuchschreiben involviert und wir verbrachten wirklich viel Zeit miteinander.
Mraz: Ungesund viel Zeit.
Eckel: Wir hatten alle Phasen miteinander: Liebe und Groll auf den anderen.
Mraz: In einer Schreibbeziehung ist es wie in einer echten Beziehung: Wenn man das gemeinsame Ziel immer noch vor Augen hat, dann hält es auch Unstimmigkeiten aus.
Weiterlesen: Wiener Zeitung
|