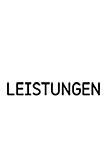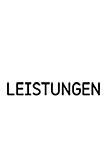Fotos © Robert Wimmer
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 10. April 2010
»Immerhin renne ich nicht mehr gegen Wände«
Elfriede Hammerl im Gespräch mit Christine Dobretsberger
Die Autorin und Kolumnistin Elfriede Hammerl spricht über ihren Kampf gegen die nach wie vor ungleiche Chancenverteilung zwischen den Geschlechtern, Mängel im Bildungssystem, Mütter-Töchter-Beziehungen – und über Morddrohungen, die sie erhalten hat
"Wiener Zeitung": Frau Hammerl, Ihr neues Buch versammelt eine Auswahl Ihrer besten Kolumnen und trägt den Titel "Alles falsch gemacht". Wie ist das zu verstehen?
Elfriede Hammerl: Ich denke, jeder kennt da s Gefühl: Was immer ich tue, es ist das Falsche. Ganz besonders häufig überkommt es Frauen, denen dies ja auch gerne eingeredet wird. Sind sie gut ausgebildet, sind sie überqualifiziert. Sind sie schlecht ausgebildet, ist es ohnedies klar, dass beruflich nichts weiter geht. Kümmern sie sich um den Beruf, vernachlässigen sie die Familie. Sorgen sie sich um die Familie, dann schauen sie nicht auf ihr berufliches Weiterkommen. Sind sie im Beruf energisch, dann werden sie als aggressiv, karrieregeil und als Mannweiber abgestempelt. Sind sie aber eher zurückhaltend, ist auch klar, weshalb alles falsch läuft.
Mit anderen Worten: Es geht um Schuldzuweisungen.
Ja, um diese ewigen Schuldzuweisungen, die dazu dienen, dass gesagt wird: Es liegt im individuellen Können des oder der Einzelnen, ob die jeweiligen anvisierten Ziele erreicht werden. Aber die Chancen sind ungleich verteilt. Das sollte man immer im Auge behalten, bevor man sagt, jeder und jede ist seines oder ihres Glückes Schmied. Natürlich kann man selber etwas dazu beitragen, aber es müssen auch die Rahmenbedingungen passen.
Das Thema ungleiche Chancenverteilung zieht sich wie ein roter Faden durch Ihr Schreiben, bezieht sich allerdings nicht nur auf Frauen.
Ganz stark geht es mir vor allem um Bildungschancen, die seit jeher sehr ungleich verteilt sind. Die alte Geschichte: Akademikereltern bekommen Akademikerkinder, Arbeitereltern im Wesentlichen Arbeiterkinder. Das hat aber nichts damit zu tun, dass die Matura oder Hochschulreife genetisch vererbt wird, sondern es hat ganz einfach mit dem Schulsystem zu tun.
Wie fühlt es sich an, wenn man mehr oder weniger sein ganzes schreibendes Leben gegen diese Ungleichheiten anschreibt – und sich im Laufe der letzten 25 Jahre im Grunde doch nicht viel verändert hat?
Historisch betrachtet, sind 25 Jahre keine lange Zeit. Wenn wir aber etwa an die Frauenbewegung denken, dann wird bereits seit 150 Jahren gleicher Lohn für gleiche Arbeit eingefordert. Mit geringem Erfolg.
Resigniert man da nicht?
Gelegentlich fühle ich mich schon etwas müde und angewidert. Wobei die Ungerechtigkeit der Welt ja prinzipiell ein Generalthema für alle Menschen ist. Ich denke, die Utopie, dass eine gerechte Welt möglich ist, darf man nicht aufgeben. Realistischer Weise muss man damit leben, dass es da und dort einen Schritt vorwärts geht, manchmal aber auch wieder zurück. Die Schritte vorwärts sollten einen motivieren, weiter zu machen.
Wie ist das Feedback auf Ihre Kolumnen? Werden Sie gelobt? Und auch angefeindet?
Seit ich für "profil" schreibe, ist die Leserpost, die ich bekomme, größtenteils positiv. Das hat möglicherweise etwas mit der Leserschaft zu tun. In den 70er Jahren, als ich im "Kurier" eine Kolumne hatte, war es sehr wohl so, dass sich einige Leute in erstaunlicher Weise empört hatten. Das ging bis zu Morddrohungen. Die habe ich nicht unbedingt ernst genommen, aber dass überhaupt jemand auf so eine Idee kommt, war schon einigermaßen verblüffend.
War diese Kolumne so scharf?
Überhaupt nicht! Im Grunde ganz harmlos. Offenbar haben es manche Menschen schon als Zumutung empfunden, dass Themen wie Gleichberechtigung überhaupt zur Sprache gebracht wurden. Aber wie gesagt: Heute ist das Feedback durchwegs so, dass ich das Gefühl habe, ich renne nicht mehr gegen Wände. Wobei man den Einfluss von Kolumnen nicht überschätzen darf. Mein Ziel ist es, ein wenig zur Bewusstseinsbildung beizutragen. Mitunter Argumente für Menschen zu formulieren, die vielleicht ähnlicher Meinung sind, dies aber nicht klar ausdrücken können. Oder die sich freuen, wenn sie in ihrer Meinung bestärkt werden.
Weil Sie zuvor die 70er Jahre angesprochen haben: Heutzutage wird der Ausdruck "70er Jahre Emanze" eher als Schimpfwort verwendet. Auch von Frauen.
Das Problem bei dieser Thematik ist, dass wir das Rad immer wieder neu erfinden. Dass sich junge Frauen stets von älteren Frauen distanzieren müssen, statt dass auf dem aufgebaut wird, was vor uns ohnedies schon herausgefunden wurde. Das hat auch damit zu tun, dass wir uns von unseren Müttern abgrenzen wollen, weil viele Mütter ein Leben führen, das in den Augen der Töchter nicht erstrebenswert ist. Sie sagen: nein, so will ich das nicht. Meine Mutter strudelt sich ab – und was hat sie jetzt davon? Der Fehlschluss ist, dies auf das Versagen der Mutter zurückzuführen, und sich zu denken: wenn ich nicht so werde wie sie, werde ich ein vergnüglicheres Leben haben. Das ist ein Irrtum. Die Mutter würde höchstwahrscheinlich auch lieber vergnüglicher leben, aber unter den gegebenen Umständen ist ihr dies eben nicht gelungen. Ein anderes Problem ist, dass Frauen immer wieder gegeneinander ausgespielt werden.
Wollen Söhne es nicht auch besser machen als ihre Väter?
Besser schon, aber nur die 68er Generation hat die Lebensmodelle ihrer Väter explizit überholt und ablehnenswert gefunden. Der Hintergrund, weshalb das ansonsten anders läuft, ist, dass Männer keine „Aufholnotwendigkeit“ haben. Es ist relativ egal, ob sie ihren Vätern nacheifern oder nicht, die gesellschaftlichen Bedingungen für sie passen soweit, auch wenn sie ebenfalls nicht immer beneidenswert sind.
Inwiefern nicht beneidenswert?
Das männliche Rollenbild hat natürlich auch durchaus seine schädlichen Auswirkungen. Dieses ständig in Konkurrenz stehen müssen, dieser Zwang, Gefühle nicht zeigen zu dürfen etc. All diese Vorgaben sind bis zu einem gewissen Grad ebenfalls eine Zumutung. Es gibt zwar eine Auseinandersetzung mit dem männlichen Rollenbild, und durchaus sehr vernünftige Erkenntnisse, aber die prinzipielle Auflehnung gegen das tradierte männliche Rollenverhalten hält sich immer noch in Grenzen.
Ich habe den Eindruck, dass in der Generation der 20- bis 25-Jährigen doch eine gewisse Veränderung stattgefunden hat. Ich denke, dass ein junger Vater die Verantwortung für das gemeinsame Kind nicht mehr zu 100 Prozent auf die Mutter abschieben kann.
Doch, das wird nur nicht direkt gesagt. Das Wording ist anders. Es wird zwar eine gewisse Hilfsbereitschaft signalisiert, aber das heißt noch lange nicht, dass es eine wirklich partnerschaftliche Arbeitsteilung gibt. Nämlich eine partnerschaftliche Teilung der unbezahlten Arbeit. Es sind immer noch die jungen Frauen, die im Zweifelsfall länger in Karenz gehen und ihr berufliches Fortkommen zurückstellen. Fakt ist, dass die Väterkarenz nur mäßig in Anspruch genommen wird. Natürlich hat das auch etwas damit zu tun, dass die Männer im Regelfall mehr verdienen, und die Situation schwieriger wird, wenn dieses Gehalt reduziert wird oder überhaupt ausfällt.
Aber entsprechende Angebote gibt es doch.
Natürlich, aber da sind wir wieder bei der Diskrepanz von Theorie und Praxis. Die Chancengleichheit ist im Gesetz verankert. Man darf auf Grund seines Geschlechts nicht benachteiligt werden. Aber wie sieht der Alltag aus? Dasgleiche gilt in diesem Fall. Man muss auch sagen, dass Männer vom Arbeitgeber stärker unter Druck gesetzt werden, wenn sie Karenz-wünsche artikulieren, als eine schwangere Frau. Männern wird vorab warnend mitgeteilt, es könnte gut möglich sein, dass sie nach ihrer Rückkehr einen anderen Job zu verrichten haben. Frauen wird das nicht direkt gesagt, aber oft passiert es ihnen genauso. Sie kehren zurück und bekommen eine andere Tätigkeit.
Welche Möglichkeit gibt es Ihrer Ansicht nach, das Thema Kindererziehung gerecht zu lösen?
Ich behaupte nicht, dass ich Patentrezepte auf Lager habe. Zunächst einmal wäre es ganz wichtig, dass Männer- und Frauengehälter nicht mehr auseinander klaffen. Und diese Diskrepanz kommt ja nicht dadurch zustande, wie oft behauptet wird, dass Frauen häufig Teilzeit arbeiten oder in Branchen tätig sind, in denen die Entlohnung generell schlechter ist. Wenn man all diese Faktoren abrechnet, bleibt immer noch ein Unterschied von rund 15 Prozent, der ausschließlich dadurch zu erklären ist, dass Frauen bei der Entlohnung diskriminiert werden. Der zweite wichtige Schritt wären ausreichende Kinderbetreuungseinrichtungen. Und auch die Bereitschaft, Risiken zu teilen. Weil eben davon auszugehen ist, dass das berufliche Fortkommen nicht nur für den männlichen Partner wichtig ist.
Wie haben Sie persönlich das Thema Kindererziehung gelöst?
Das war sehr schwierig. Meine Tochter war zwei Jahre alt, als ihr Vater und ich uns getrennt haben. Ich war zum damaligen Zeitpunkt freie Journalistin und arbeitete zu Hause. Ich schrieb für verschiedene Medien und hatte das Glück, dass damals sehr gut bezahlt wurde. Somit konnte ich mir stundenweise Babysitter leisten. Natürlich habe ich sehr darauf gewartet, dass meine Tochter drei Jahre wird und in den Kindergarten gehen kann. Als es dann soweit war, wollte sie allerdings nicht dort bleiben, was einzig und allein mit dem Kindergarten zu tun hatte. Also war sie wieder bei mir zu Hause und ich versuchte Tag für Tag, alles unter einen Hut zu bekommen. Ich habe zwangsweise oft in der Nacht gearbeitet und über viele Jahre hinweg sehr wenig geschlafen. Wie gesagt: Für jede Minute, die ich nicht mit meinem Kind verbracht habe, habe ich bezahlt.
Wie ging es dann in der Schulzeit weiter?
Im Grunde genommen genauso mühsam, weil meine Tochter in eine Halbtagsschule ging. Wobei von einem halben Tag ohnedies keine Rede sein konnte. Volksschulkinder werden um 8 Uhr in die Schule gebracht und sind um 11 Uhr wieder zu Hause. In der Zwischenzeit sollte man eigentlich gekocht und die eigene Arbeit voran gebracht haben. Wie soll sich das ausgehen? In meinem Fall kam noch hinzu, dass die Menschen in meinem Umfeld befunden haben, ich hätte ohnedies nichts zu tun, weil ich eben zu Hause arbeitete. Es war überhaupt kein Verständnis vorhanden, dass ich eigentlich eine berufstätige Person bin.
Inwiefern hat sich das bemerkbar gemacht?
Das allgemeine Bewusstsein war, dass man mich jederzeit beim Arbeiten unterbrechen kann. Was de facto auch der Fall war. Ich denke, das ist ein grundsätzliches Problem. Auch wenn immer von den vielen Vorzügen der Telearbeit die Rede ist. Letztendlich ist es dennoch einfacher, die Türe hinter sich zuzumachen und zu sagen: Mutter geht jetzt ins Büro, bis später. Ich habe das nicht geschafft.
Wenn Sie sich heute in Ihre damalige Situation zurückversetzen – gäbe es etwas, das Sie heute anders, vielleicht besser machen würden?
Wahrscheinlich nicht. Für mich war es trotz allem die Lösung, die mir am besten erschienen ist. Aber da sind wir wieder beim Thema Rahmenbedingungen. Eine Ganztagsschule hätte mir sicherlich sehr geholfen. Die Schulreform wäre wirklich an der Zeit.
Für welches Schulmodell plädieren Sie? Für Ganztagsschule oder für Gesamtschule?
Für beide Schulmodelle. Ich bin für eine gemeinsame Schule der 6- bis 15-Jährigen. Und ich plädiere für Ganztagsschulen, wo der Stundenplan sowohl das Erlernen von neuem Stoff als auch das Vertiefen und Üben des Gelernten vorsieht. Dazwischen muss ausreichend Raum für Essen, Freizeit und Bewegung vorhanden sein. Ein ganz wesentlicher Punkt ist, dass endlich ein Umdenken stattfindet. Ein Kind, das in eine Ganztagsschule geht, ist kein abgeschobenes Kind. Vorraussetzung ist natürlich, dass es sich um eine qualitätvolle Einrichtung handelt. Niemand überlässt sein Kind gerne einer Institution, bei der offenkundig ist, dass die Kinder dort unglücklich sind. Aber das muss nicht sein. Wenn es in anderen Ländern funktioniert, warum sollte es in Österreich nicht auch klappen?
Zuerst müsste natürlich eine entsprechende Infrastruktur geschaffen werden.
Ich denke, zuvor müsste überhaupt erst ein ernsthafter Wille vorhanden sein, die passenden räumlichen Bedingungen herzustellen. Seit den 70er Jahren wird dieses Thema diskutiert. Bisher gab es keine ernsthaften Ansätze, lediglich Schulversuche.
Plädieren Sie für die Schulreform aus Sicht der Eltern oder der Kinder?
Zunächst aus der Sicht der Kinder. Eben weil es eine Möglichkeit ist, Bildungsdefizite einigermaßen zu kompensieren. Bei uns wird vorausgesetzt, dass ein Kind, das ins Gymnasium geht, Eltern hat, die ihm bei den Aufgaben helfen können. Kinder, bei denen dies nicht der Fall ist, sind schon einmal gewaltig im Nachteil. Eine gemeinsame Ganztagsschule, die auch das Üben und Vertiefen des Stoffes übernimmt, könnte die ungleichen Chancen ein wenig kompensieren.
Und aus der Sicht der Eltern?
Man kann nun einmal nur dann berufstätig sein, wenn die Kinder nicht um 11 Uhr nach Hause kommen. Zum anderen darf man meiner Ansicht nach nicht einfach davon ausgehen, dass selbst gebildete Eltern in der Lage sind, beim gemeinsamen Lernen didaktisch richtig vorzugehen. Dafür gibt es nun einmal Menschen, die das gelernt haben, und deshalb soll sich die Schule auch darum kümmern. Für Eltern gibt es ohnedies noch genügend Aufgaben, die wahrzunehmen sind.
Sie sehen das als ein Abschieben der Verantwortung ins Private?
Das ist generell eine Entwicklung, die ich mit großem Missfallen beobachte. Allerorts wird die Familie als paradiesische Formation propagiert, in der sich alle wohl fühlen. Ständig wird betont, wie wichtig die Familie ist. In Wirklichkeit läuft es auf ein Abschieben der Verantwortung ins Private hinaus. Die sozialen Netze werden immer grobmaschiger und die Menschen dazu angehalten, sich im Notfall doch bitte an die Verwandtschaft zu wenden. Es ist wirklich schade, dass die Solidarität in Verruf geraten ist, dass das Gefühl, füreinander verantwortlich zu sein, ins Hintertreffen geraten ist.
Solidarität in welchem Sinne?
Von Mensch zu Mensch, mit einem entsprechenden gesellschaftlichen Konsens. Es ist ja kein Zufall, dass Einrichtungen wie das Gesundheitssystem, die Alterspension, öffentliche Kindergärten oder Schulen entstanden sind. Weil sich eben gezeigt hat, dass die Familie nur unzureichend in der Lage ist, wirtschaftliche, bildungstechnische oder gesundheitspolitische Sicherheiten für alle Menschen zu garantieren. Wenn man nun wieder den Familiensinn propagiert, dann bedeutet das im Grunde, bestehende Verhältnisse zu zementieren. Wenn ich ein Kind aus einer wohlhabenden und einflussreichen Familie bin, dann ist mir die Familie von Nutzen, dann habe ich ein Netz an gesellschaftlichen Verbindungen und bin materiell abgesichert. Wenn ich aber ein Kind einer armen Familie bin, habe alle diese Absicherungen nicht. Denken Sie an Entwicklungsländer: Jeder, der es dort ein bisschen weiter bringt, ist verpflichtet, der Verwandtschaft etwas abzugeben, für sie zu sorgen – und kommt selbst nicht weiter. Das kann es ja nicht sein. Ich betrachte dieses scheinheilige Familiensinn-Geschwafel als eine Bedrohung unseres sozialen Netzes.
Weiterlesen: Wiener Zeitung
|