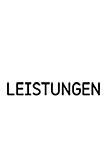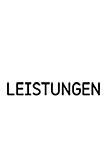© Robert Wimmer
|
INTERVIEW Wiener Zeitung, Printausgabe 13. Mai 2017
»Die Sehnsucht nach meiner Heimat wächst«
Christine Dobretsberger im Gespräch mit Houchang Allahyari
Der in Teheran geborene Houchang Allahyari über sein Leben als Psychiater und Filmemacher in Wien - und über Erinnerungen an den Iran seiner Kindheit.
"Wiener Zeitung": Herr Allahyari, als Einstieg in Ihr kürzlich erschienenes Buch "Normalsein ist nicht einfach" erzählen Sie, dass Sie als junger Psychiater in der Linzer Nervenheilanstalt Wagner-Jauregg Paul Wittgenstein, den Neffen des weltberühmten Philosophen, kennengelernt haben. Er war in jener Abteilung Patient, in der Sie Ihre Teilausbildung absolviert haben. Dieser Mann dürfte einen nachhaltigen Eindruck auf Sie hinterlassen haben?
Houchang Allahyari: Deswegen heißt mein Buch auch "Normalsein ist nicht einfach". Paul Wittgenstein war so witzig, klug und interessant, dass man meiner Meinung nach nicht einfach sagen konnte: Dieser Mensch ist psychisch krank. Natürlich hat er manchmal Aktionen gesetzt, die an der Grenze waren, beispielsweise als er sein ganzes Geld unter den Armen verteilt hatte und selbst in finanzielle Not geriet. Er hat in zyklischen Abständen freiwillig den Weg ins Krankenhaus gesucht, weil es ihm in diesen Phasen offensichtlich schlecht gegangen ist und er selbst gespürt hat, dass seine psychische Verfassung manchmal an der Kippe ist.
Thomas Bernhard hat Paul Wittgenstein ein literarisches Denkmal gesetzt. Haben Sie "Wittgensteins Neffe" gelesen?
Natürlich. Das war auch der Grund, weshalb der Name der einzig reale ist, der in meinem Buch vorkommt, eben weil Thomas Bernhard dieses Werk bereits viele Jahre zuvor geschrieben hatte. Abgesehen davon war Paul Wittgenstein nicht mein Patient. Er war für mich vielmehr ein Freund, ein anregender Gesprächspartner bei Nachtdiensten und hat mir sehr viel erzählt, auch von seiner Freundschaft mit Thomas Bernhard.
Wie finden Sie Bernhards Beschreibung von Paul Wittgenstein?
Er interpretiert die Persönlichkeit von Paul Wittgenstein natürlich auf künstlerische Weise. Aber es gibt viele Sätze, die ich sehr zutreffend finde, gerade wenn er Situationen beschreibt, wo Grenzen erreicht werden und der Mensch eben explodiert. Natürlich ist es auch ein Werk, bei dem man sich manchmal denkt, das ist jetzt vielleicht selbst ein bisschen über der Grenze, aber das gehört zu Thomas Bernhards literarischem Schaffen ja dazu.
. . . ebenso wie die Tatsache, dass Ärzte generell nicht gut wegkommen und Psychiater im Besonderen. In "Wittgensteins Neffe" gibt es den Satz: "Der psychiatrische Arzt ist der inkompetenteste und immer dem Lustmörder näher als der Wissenschaft ..."
Ich muss sagen, vielleicht hat er gar nicht einmal so Unrecht, denn in der Zeit, als Paul Wittgenstein in Behandlung war, herrschte auf dem Gebiet der Psychiatrie tatsächlich noch tiefstes Mittelalter. In den 1960er Jahren bestand die sogenannte Therapie in erster Linie in der Verabreichung von Elektroschocks in Kombination mit Medikamenten, die allerdings bei weitem nicht die Fortschritte brachten, wie wir sie heute haben.
Weil Sie mit dieser Behandlungsform absolut nicht einverstanden waren, haben Sie sich als junger Arzt geweigert, die Narkosespritze zu verabreichen, die eine Elektroschock-Therapie einleitete . . .
Ja, allein die Vorstellung war ein Horror für mich. Unter Psychiatrie hatte ich mir etwas ganz anderes vorgestellt. In der Mittelschule in Teheran haben wir viel über Freud, Jung und Adler diskutiert und gelesen. Dann kam ich hierher und das Einzige, was man mir in meiner Ausbildung beibringen wollte, war die Schockbehandlung. Ich möchte jetzt keinesfalls verallgemeinern, auch damals gab es Psychiater, die bereits in Richtung Psychotherapie gearbeitet haben, aber im Großen und Ganzen war die Elektroschock-Therapie damals Standard - und so gesehen ist Thomas Bernhards Kritik nicht unberechtigt. Ich bin sehr froh darüber, dass sich im Bereich der Psychia-trie im Laufe der Zeit sehr viel zum Positiven verändert hat.
Dass Sie bereits als junger Arzt ausführliche Gespräche mit Patienten geführt haben, war damals sozusagen eher therapeutisches Neuland?
Diese Gespräche habe ich intuitiv geführt, das war nichts Erlerntes. Bis heute finde ich die menschliche Beziehung zwischen Arzt und Patient das Wichtigste. Wenn diese nicht entsteht, funktioniert eine Therapie nicht. Das widerspricht natürlich völlig der Theorie von Freud, der die Persönlichkeit des behandelnden Arztes in großer hierarchischer Distanz zum Patienten sah. Ich hatte großes Glück, dass ich in Linz die Möglichkeit bekam, in Ruhe mit den Patienten zu reden. Ich habe die Leute auch nie als krank betrachtet.
Houchang Allahyari im Gespräch mit "Wiener Zeitung"-Mitarbeiterin Christine Dobretsberger.
Würden Sie sagen, dass generell in der Psychiatrie ein weniger hierarchisches Verhältnis zum Patienten besteht als beispielsweise in der Chirurgie?
Die Arbeit eines Chirurgen und einen Psychiaters kann man sehr schwer vergleichen. Wenn ein Mensch über seine Psyche redet, über die intimsten Dinge seiner Seele, muss das Vertrauen vergleichsweise natürlich viel größer sein und schrittweise entstehen. Der Patient muss das Gefühl haben, dass man sich für seine Probleme interessiert. Viele denken, jetzt arbeitest du schon 40, 50 Jahre als Psychiater, jetzt hast du schon so viel Routine, dass du die Sorgen der Patienten wohl nicht mehr so ernst nehmen wirst. Aber bei mir ist es umgekehrt! Je älter ich werde, desto größer wird mein Interesse, weil nun viel Erfahrung dahinter steckt.
weiterlesen: Wiener Zeitung
|